Bertolt Brecht - Der gute Mensch von Sezuan
Wie soll ich gut sein, wo alles teuer ist?
Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ aus dem Jahre 1943 beginnt wie eine göttliche Heilsfantasie: Drei Götter steigen vom Himmel herab, um endlich jemanden zu finden der ihre Gebote hält. Sie finden Shen Te, eine Prostituierte. Sie erhält Geld, Hoffnung, und wird ins Verderben geschickt. In Sezuan gibt es keinen Platz für Güte ohne Kalkül „Wie soll ich gut sein, wo alles teuer ist?” fragt Shen Te – bekommt allerdings keine Antwort. Wer teilt, verliert. Wer nachgibt, wird zerdrückt und wer auf die Götter hofft, hat bereits verloren. Shen Te wird zur Symbolfigur eines Paradoxons: Sie will gut sein- überleben kann sie jedoch nur als Shui Ta, der kühl erklärt: „Der Laden [ist] kein Asyl, Ihr Eigensüchtigen“.
Sezuan ist keine naive Dystopie, sondern eine Welt, in der „die Guten es schwer haben“, in der Empathie als Schwäche gilt und Menschlichkeit ein Luxus ist, den man sich leisten können muss.
Inhaltsangabe - Wer gibt, verliert
Drei Götter steigen vom Himmel herab auf der Suche nach einem guten Menschen der ihre Gebote lebt. „Seit zweitausend Jahren geht dieses Geschrei, es gehe nicht weiter mit der Welt“, verkünden sie, doch selbst jetzt scheint kaum jemand bereit, ihnen Obdach zu geben. Nur Shen Te, eine arme Prostituierte, nimmt sie auf. Als Belohnung erhält sie Geld, mit dem sie sich einen Tabakladen kauft. „Ich hoffe, jetzt viel Gutes tun zu können“, sagt sie – und öffnet damit zugleich Tür und Tor für ihre eigene Ausbeutung. Die Bedürftigen kommen in Scharen. Freunde, Verwandte, Schnorrer – „eine achtköpfige Familie hat sie bei sich beherbergt!“ – und Shen Te gibt, was sie kann. Doch ihre Gutmütigkeit wird ihr zur Falle. „Sie kann nicht nein sagen!“, heißt es bald, während ihr Laden zum Obdachlosenasyl verkommt.
Um nicht unterzugehen, erfindet sie den Vetter Shui Ta. Er ist kühl, streng, und vor allem geschäftstüchtig. Unter seinem Regiment wird aufgeräumt. Die Nutznießer werden vertrieben, das Geschäft floriert, aber Shen Te selbst beginnt zu verschwinden.
Als sie sich in den abgehalfterten Flieger Yang Sun verliebt, wird sie erneut ausgenutzt. Sie wird schwanger, verarmt, und Shui Ta muss wieder übernehmen. Schließlich betreibt er ein florierendes Unternehmen, während Shen Te vermisst wird. Im weiteren Verlauf der Geschichte klagt man Shui Ta sogar an, seine Cousine ermordet zu haben. Doch niemand erkennt, dass beide eins sind: zwei Masken, gezwungen von einer Welt, in der Menschlichkeit keinen Platz hat.
Wo Gutsein zum Fehler wird
Shen Te will gut sein. Sie will helfen: „Ich hoffe, jetzt viel Gutes tun zu können“, sagt sie zu Beginn, doch diese Hoffnung ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Denn Brechts Sezuan ist kein Ort für Mitgefühl. Es ist ein Schlachtfeld, auf dem Mitleid nicht edel ist, sondern töricht – ein Luxus, den sich niemand leisten kann.
Die ökonomische Realität schlägt zu. Shen Te steht nicht nur zwischen Bedürftigen, sondern zwischen Rechnungen, Mietforderungen und eigenen Ängsten. „Wie soll ich gut sein, wo alles teuer ist?“, fragt sie verzweifelt, und das Stück gibt eine klare Antwort: Gar nicht. Denn in einer Welt, in der der Mensch nur zählt, wenn er nützt, wird Güte zur Schwäche.
Die Gesellschaft von Sezuan kennt keine Solidarität. Wer nicht zahlt, fliegt raus. Wer schwäche zeigt, wird zerfressen. Shen Te wird zur Spielball all jener, die etwas wollen – ihre Hilfe, ihr Vertrauen, ihr Geld. „Sie kann nicht nein sagen!“, sagt eine Frau und meint: Wer das nicht kann, hat in dieser Welt nichts verloren. „Wirf ein Stück Fleisch in eine Kehrichttonne, und alle Schlachterhunde des Viertels beißen sich in deinem Hof“ warnt die Frau Shen Te und zeigt ein System, in dem Schwäche sofort zum Raubobjekt wird.
Was Brecht hier offenbart, ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern ein Prinzip. In Sezuan scheitert nicht eine einzelne Figur an der Moral, es ist die Moral selbst, die im System keinen Platz findet. Nicht das Böse zerstört das Gute, sondern Verhältnisse, in denen Mitgefühl als Schwäche gilt und Hilfsbereitschaft ökonomisch bestraft wird. „Die Guten haben es schwer“, sagt Wang weil Moral in einer Welt, die nur nach Nutzen fragt, keinen Kurswert mehr hat.
Am Ende wird Shen Te selbst zur Täterin an ihrer Moral. Sie muss sich auflösen, verwandeln, verhärten, um zu überleben. Ihre Güte ist echt, aber in diesem System ist das eine tödliche Eigenschaft.
Die Maske Shui Ta: Selbstschutz als Verrat
Als Shen Te erkennt, dass ihre Gutmütigkeit sie vernichtet, tut sie, was in Brechts Welt die einzige Überlebensstrategie ist: Sie spaltet sich. Aus der sanften Shen Te wird der kühle Shui Ta – einer, der nicht fragt, sondern handelt. Der nicht gibt, sondern kalkuliert. Der nicht weint, sondern die Nutznießer, die sich an Shen Tes Gutmütigkeit fettgesogen haben, ohne Wenn und Aber vertreibt.
In Shui Ta wird sichtbar, was man in dieser Gesellschaft sein muss, um nicht zugrunde zu gehen: rechnerisch, hart und durchsetzungsstark. „Der Laden war kein Asyl, ihr Eigensüchtigen!“, schleudert Shui Ta der hungrigen Menge entgegen und sagt damit, was Brecht eigentlich meint: Moral ist kein Geschäftsmodell, mit dem man überleben kann.
Diese Spaltung kommt mit einem Preis. Shen Te bleibt zwar lebendig, innerlich jedoch zerrissen und verzweifelt. Sie verschwindet hinter Shui Ta, und niemand merkt es: „Ich verlange, dass Fräulein Shen Te geholt wird. Sie ist anscheinend ein besserer Mensch als Sie“, sagt der Schreiner, und verlangt damit genau die Figur zurück, die er eben noch schamlos ausgenutzt hat.
Shui Ta ist kein Monster. Shui Ta zeigt, was man werden muss, um nicht zugrunde zu gehen – und gerade das macht die Figur so tragisch. Shen Te will leben, aber sie darf nur als jemand existieren, der sie nicht ist.
Die Götter: Weltfremd, wirkungslos, zynisch
Sie kommen vom Himmel und bringen nichts als Appelle. Die drei Götter in Brechts Stück sind keine Heilsbringer, keine Ratgeber, keine Schutzengel. Sie sind Funktionäre einer Idee, die längst mit der Realität kollidiert ist: die Idee, dass das Gute sich schon durchsetzen werde, wenn man es nur wolle. „Du kannst es. Sei nur gut, und alles wird gut werden!“, sagen sie am Ende und liefern damit den zynischsten Satz des ganzen Dramas.
Dabei sehen sie alles. Sie hören Shen Tes Verzweiflung, erleben ihre Zerrissenheit, bestaunen ihre Opferbereitschaft. Und dennoch weigern sie sich, aus ihrer Ideologie auch nur einen Millimeter herauszutreten. „Sollen wir eingestehen, daß unsere Gebote tödlich sind? Sollen wir verzichten auf unsere Gebote? Verbissen: Niemals! Soll die Welt geändert werden? Wie? Von wem? Nein, es ist alles in Ordnung!“
Ihre Haltung ist nicht naiv sondern autoritär. Sie verteidigen ein System, das längst zerstörerisch geworden ist, und verstecken sich hinter dem Mantel moralischer Prinzipien. Es ist kein Missverständnis – es ist Dogma. „Sollen wir eingestehen, daß unsere Gebote tödlich sind? […] Niemals!“ – das ist nicht Zweifel, das ist ideologische Verbohrtheit.
Man begegnet diese Haltung überall dort, wo Prinzipien wichtiger werden als Menschen.Wo diejenigen urteilen, die selbst niemals riskieren müssen, Unrecht zu erfahren. Die Götter stehen für die Instanzen der Norm, die sich nicht korrigieren lassen, weil sie sich für unfehlbar halten.
Am Ende steigen sie wieder auf und hinterlassen eine Welt, die keinen Deut besser ist als zuvor. Sie loben Shen Te, ermahnen sie weiterzumachen und entziehen sich jeder Verantwortung. So bleibt das Stück nicht nur ein moralisches Drama, sondern auch eine Abrechnung mit leerer Autorität. Das Urteil der Götter ist ein Hohn.
Wenn Gutsein kein Ausweg mehr ist
Shen Te will das Richtige tun und muss dafür verschwinden. Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ ist keine Parabel über den Triumph des Guten, sondern eine bittere Diagnose: Wer in einer Welt lebt, in der die Kosten-Nutzen-Rechnung moralisches Handeln entwertet, läuft Gefahr, durch Mitgefühl zugrunde zu gehen. Moral wird dort nicht belohnt – sie wird bestraft. Nicht weil sie falsch wäre, sondern weil sie keinen Platz mehr hat.
Die Götter verschwinden, die Moral auch. Übrig bleibt eine Gesellschaft, die Menschen nur als Funktionsträger kennt: nützlich oder überflüssig, stark oder schwach, berechnend oder verloren. Shen Te bleibt zurück, zerbrochen zwischen Anspruch und Realität. Ihre Menschlichkeit ist echt - ihr Untergang auch.
Brecht schließt diese Tragödie nicht mit Trost, sondern mit Spott: „Du kannst es. Sei nur gut, und alles wird gut werden!“ Ein Satz, der wie eine letzte Ohrfeige klingt – gegen Shen Te, gegen uns alle. Denn vielleicht will dieses Stück gar keine Antwort geben. Vielleicht will es nur die Frage brennen lassen: Was ist das für eine Welt, in der man gut sein will und es nicht darf?

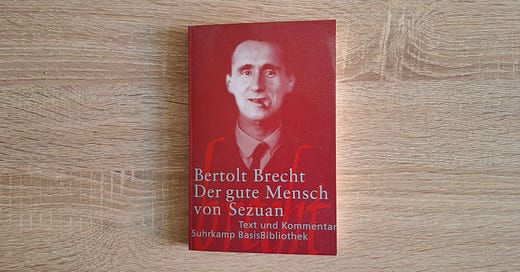



Tolle Kritik. Ich habe das Werk vor über 30 Jahren gelesen. Schon erstaunlich wie zeitlos es ist und auf die heutige Zeit anwendbar!